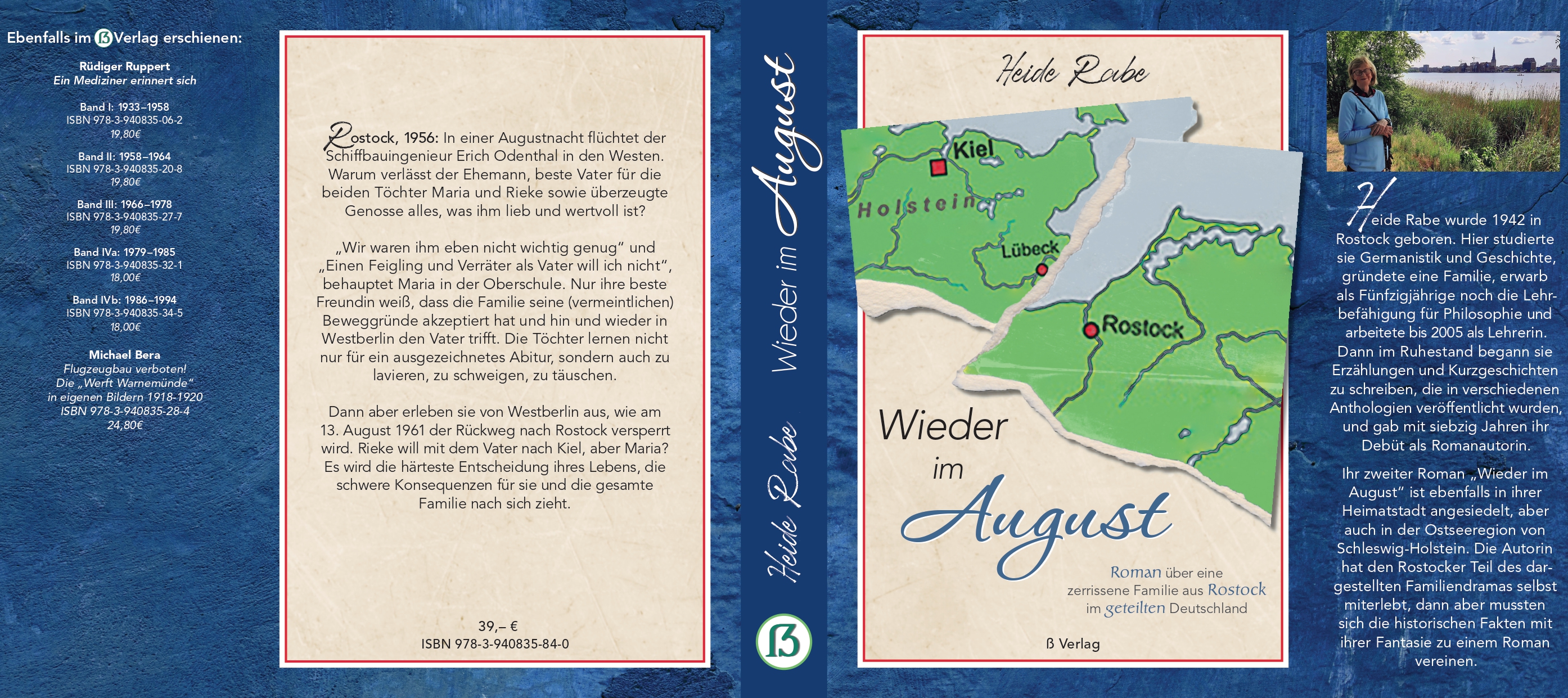„Wie würden Sie sich selbst beschreiben?“, wollte kürzlich der Moderator einer Kochsendung von einem aufgeregten Kandidaten wissen. Lieber Himmel, der kann doch kaum Luft holen vor wildem Herzrasen. Und dann diese Frage? Ich hätte vermutlich einen totalen Blackout bekommen in einer solchen Situation. So dachte ich und testete meinen Tom mit dieser Frage. „Ruhig, ausgeglichen, immer freundlich.“ Er konnte sich kaum bremsen bei der Aufzählung seiner Vorzüge und ich musste laut lachen. „Nicht total daneben, aber …“ Ich verkniff mir die Fortsetzung des Satzes, beschloss aber, irgendwann ernsthaft über diese Frage nachzudenken, die dann mich betreffen sollte. Doch der Kandidat schien gut vorbereitet worden zu sein, fand schnell eine Antwort und eine gewisse Gelassenheit. „Meine Freunde würden sagen, ich bin hilfsbereit, für jeden Spaß zu haben und humorvoll.“
Humorvoll! Witzig! Schlagfertig! Absolute Lieblings- und Sympathiewörter. Doch leider, so denke ich zumindest, Tom und ich sind beide nicht oder nur minimal gesegnet mit diesen Eigenschaften. Und hin und wieder erscheint mir dies als ein riesengroßes Manko. Ich beneide Leute, die die Begabung haben, schwierige Situationen mit Witz und Leichtigkeit zu entspannen und Zuhörer zu einem Lächeln oder Lachen zu bringen. Ohne krampfhaftes Überlegen finden sie – so ganz nebenbei – genau die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt. Aber man soll es lernen können, bzw. es üben, mit einer bestimmten inneren Haltung gelassener den kleinen Alltagswidrigkeiten zu begegnen.
Das wollte ich genauer wissen. Das ‚kluge und allwissende Internet‘ verriet mir sieben Tipps und praktische Übungen, um ein humorvoller Mensch zu werden. Und das sollte bei jedem in jedem Alter funktionieren, falls die genetische Veranlagung etwas sparsam diese Charaktereigenschaften hinterlassen hatte. Man sollte:
- den Perspektivwechsel üben
- positive Gesellschaft suchen
- über sich selbst lachen
- authentisch sein
- eine positive Einstellung entwickeln
- humorvolle Literatur lesen
- Selbstvertrauen aufbauen
Der Vollständigkeit wegen fragte ich dann das Internet über humorlose Menschen aus. Sie seien meist wenig intelligent, befangen, verklemmt, gehemmt, unentspannt und verkrampft. „Das ist doch totaler Unsinn“, schimpfte ich und lachte gleich darauf erleichtert. Denn nichts davon traf auf mich und Tom zu. Also, und das erschien mir logisch, sind die wertvollen positiven Charaktereigenschaften mit Sicherheit auch bei uns vorhanden, wahrscheinlich aber zeitweise verschüttet und wenig trainiert worden. Wie hätten wir sonst wohl über vierzig Jahre im Lehrerberuf überleben und nicht nur halbwüchsigen Schülern, sondern auch wohlgeratenen Kindern, Enkeln und einem Urenkelchen den Weg ins Leben ebnen können. Zumindest haben wir einen kleinen Anteil daran. Hoffentlich! Das kann doch nur mit einer gehörigen Portion Humor funktioniert haben. Also, alles ist gut, wir sind noch zu retten. Aber ich wollte es genauer wissen, besser gesagt, ich wollte uns testen. Endlich war es an der Zeit, die „Rentner-Witze“ aus meinem Bücherschrank zu kramen, um auch die Rubrik ‚humorvolle Literatur lesen‘ abhaken zu können. Irgendwann hatten wohlmeinende Kaffeegäste dieses Mitbringsel überreicht, aber gelesen hatte wir darin nie. Eigentlich hätte ich es wissen müssen: Begeisterung kam nicht auf. Die Rentner-Witze waren nicht unser Ding und Mario Barth nebst Kolleginnen und Kollegen mögen uns verzeihen, wenn wir sie auch künftig ignorieren werden. Wir gehören einfach nicht zu ihnen, den kreischenden, johlenden, auf die Schenkel klopfenden Hauptsache-wir-haben-Spaß-Zeitgenossen. Vielleicht sind wir zu norddeutsch-kühl, zu introvertiert? Nun reicht’s aber mit dem Seelen-Striptease, beschloss ich. Schluss. Wir sind wie wir sind und mögen uns auch so!
Doch wir kam ich überhaupt auf dieses Thema? Vermutlich ist es die immanente Sorge und Traurigkeit, die mich bedrückt. Zum Glück hat sie nichts mit unserer persönlichen Lebenssituation zu tun, die kaum besser sein könnte. Aber schließlich leben wir nicht allein auf Wolke sieben im Nirgendwo, sondern sind Teil eines Ganzen, einer Gemeinschaft. Und dieses Ganze beunruhigt mich zutiefst und wäre auch nicht mit Humor zu ertragen.
Ein kleines Beispiel? Mein Tom braucht rund um die Uhr meine Betreuung und Unterstützung. Wohin er auch muss, ich bin dabei, fahre ihn zu Terminen mit dem Auto (Rollstuhl /Rollator im Kofferraum) und hin und wieder benutzen wir auch die Öffis. Nun gibt es sicher nicht nur in Rostock Parkplatzprobleme und oft sehe ich wehmütig die leeren Behindertenparkplätze, für die ich mit Tom keine Parkberechtigung habe. So kam mir die Idee, einen Antrag für einen Schwerbehindertenausweis für meinen Lieblingsmenschen zu stellen. Das tat ich im März beim örtlichen Versorgungsamt, nachdem ich und auch unsere Hausärztin diverse Formulare ausgefüllt, ärztliche Gutachten und Diagnosen kopiert hatte. Mitte Juni, also nach drei Monaten, wurde die Schwerbehinderung rückwirkend anerkannt. Der Grad der Behinderung: 100, die Buchstaben G (gehbehindert) und B (Begleitung notwendig) – sind auf dem Ausweis zu lesen. Doch mir ging es vor allem um das blaue Rollstuhl-Piktogramm, das im Auto angebracht wird und mir die Legitimation erteilen soll, dass ich einen entsprechenden Parkplatz nutzen kann, wenn Tom mein Beifahrer ist. In meiner anfänglichen Naivität glaubte ich, mit dem Ausweis in der Hand bei Autozubehör, Sanitätshaus, Ordnungsamt oder ähnlichen Anlaufpunkten fündig zu werden. Beim Ordnungsamt wurde mir Adresse und Telefonnummer vom Tiefbauamt mitgeteilt, denn dem wiederum sei eine Abteilung untergeordnet, die Sondernutzungserlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen und Parkberechtigungen erteilt. Hurra, wieder was dazugelernt. Nach einem weiteren Telefonat wurden mir per Mail wieder Formulare zugeschickt, die ich ausdrucken, ausfüllen und dem Amt zusenden sollte. Ich staunte, denn nun sollte ich den Schwerbehindertenausweis und Toms Personalausweis kopieren, wiederum ärztliche Diagnosen einreichen und auch meine Personalausweis-Kopie plus Vollmacht, die mich als Betreuerin meines Ehemannes ausweist, hinzufügen. Fragen sollten beantwortet werden, die mir bereits im März vom Versorgungsamt gestellt worden waren und deren Antwort die Grundlage für die anerkannte Schwerbehinderung bildeten. Ich verstand die Welt nicht mehr. Zwei Ämter einer Stadtbehörde, hätte da nicht ein kollegiales Telefonat oder ein innerbetrieblicher Mailverkehr genügt? Sei wie’s sei, als braver Staatsbürger tat ich meine Pflicht, steckte alles in einen Umschlag und versenkte es in den behördlichen Briefkasten. Das geschah Ende Juni. Jetzt haben wir Mitte August, aber eine blaue Rollstuhlplakette ist immer noch nicht in Sicht.
Heute ergab eine freundliche Nachfrage, dass mein ‚Antrag auf Erteilung einer Parkerleichterung für Schwerbehinderte‘ nun zur Anhörung zurück zum Versorgungsamt geschickt worden sei. Also zu der Stelle, die den Ausweis ausgestellt hatte. Nun wird dort geprüft, ob die Anforderungen für eine Parkerleichterung erfüllt sind oder nicht. Das Ergebnis werde dann wieder ans Tiefbauamt zurückgeschickt und irgendwann uns mitgeteilt werden. Vielleicht als Weihnachtsgeschenk?
Nun wundert mich auch nicht, weshalb die Behindertenparkplätze meist leer sind. Der Behördenmarathon wird viele abschrecken und der Humor ist mir wieder mal abhanden gekommen, obwohl ich ihn mit Perspektivwechsel, positiver Einstellung und Selbstvertrauen anzulocken versuchte.
Ich weiß, ich weiß, das sind doch nur Bagatellen, Peanuts, Rentner haben doch Zeit. Da gibt es doch ganz andere und viel gravierendere Beispiele, echte Missstände, die ganze Betriebe zugrunde richten. Ja, und das ist es eben.
Trotzdem, vergesst das Lachen nicht und verliert euren Humor nicht ganz.