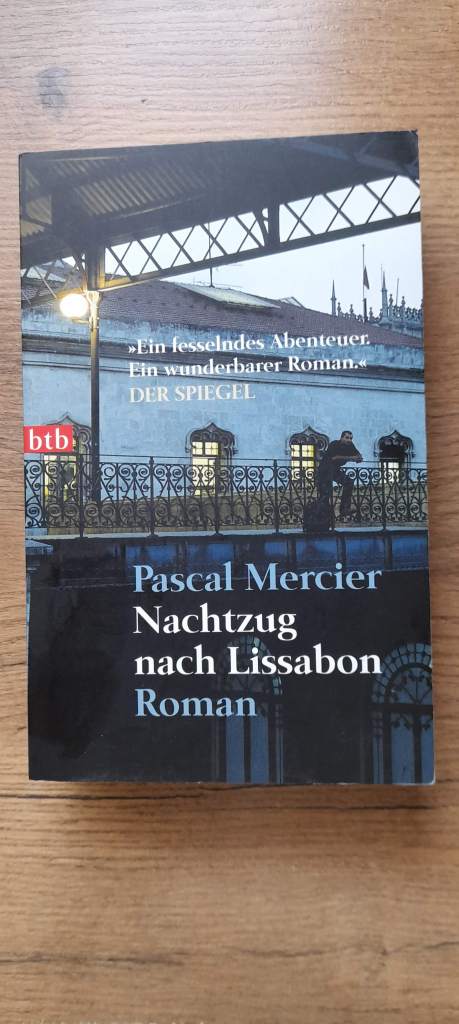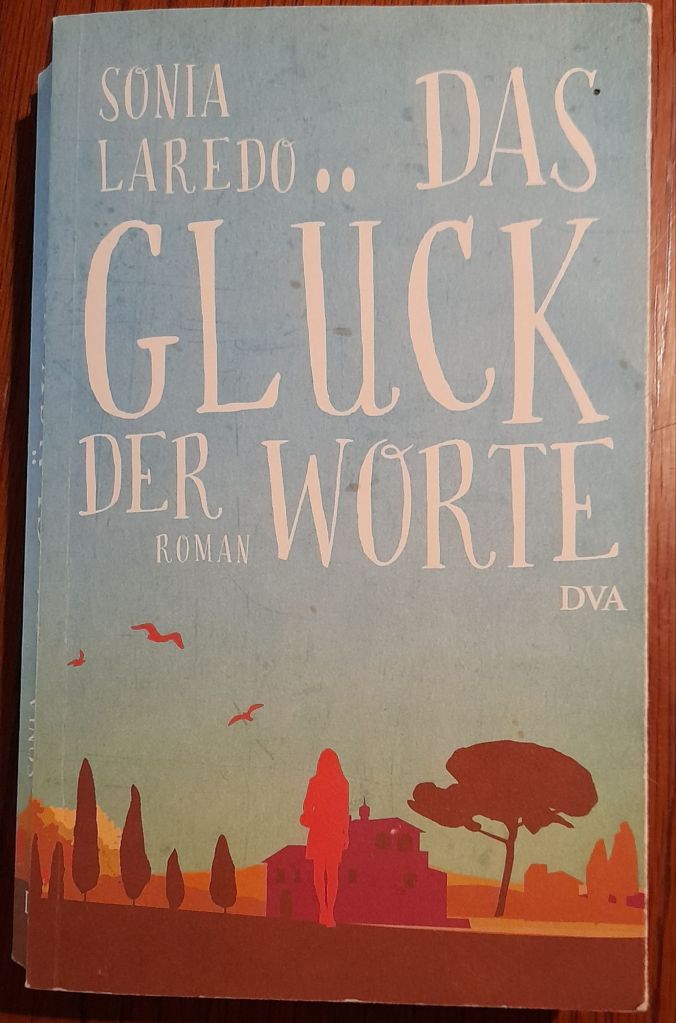Ihr erinnert euch? Rosi hatte nach ihrem Blitzbesuch versprochen, sie werde mich anrufen. Natürlich war ich gespannt auf ihre Lebensgeschichte. Aber war es überhaupt möglich, diesen Zeitgraben von fünfzig Jahren zu überspringen und unsere damalige Kinderfreundschaft wieder aufleben zu lassen? Tom möchte etwas über sie wissen und hilft mir damit, mich zu erinnern. Ich zeige ihm alte Klassenfotos und bin dankbar, dass an jedem Schuljahresende ein Fotograf gekommen war, der unsere Rasselbande samt Klassenlehrerin verewigte.
„Das ist sie!“ Ich wies auf die kleine Zehnjährige mit den dunklen Wuschelhaaren, fast schwarzen Augen, ernstem Gesicht, akkurat gekleidet. Obwohl nur der Oberkörper zu sehen war und der weiße Blusenkragen, der unter einem dunklen Pullover hervorblitzte, erkannte ich dich sofort und in meinem Kopf tauchte die gesamte Gestalt der kleinen Rosi auf. Warum warst du nur immer so ernst, irgendwie traurig? Ich konnte mich an kein herzliches Lachen, albernes Kichern oder fröhliches Spiel erinnern. Niemals musste dich ein Lehrer ermahnen oder kritisieren. Doch damals hatte mich dies nicht gestört oder zum Nachdenken gebracht. Schließlich hatte ich noch andere Spielgefährten in der Nachbarschaft, hatte so was wie Freunde für alle Fälle. Du warst Rosi. Und so wie du warst, so mochte ich dich. Aber weshalb du so plötzlich verschwunden warst, das musste sie mir unbedingt erklären.
Rosi hielt Wort. Noch am nächsten Abend rief sie mich an und es folgten ungezählte Telefonate. Ja, es schien zu funktionieren. Wir freuten uns aufeinander. Mal riefs du an, mal ich. Wir hatten die Abendstunden vereinbart, in denen wir ungestört reden und zuhören konnten. Und wir hatten viel zu fragen, zu verstehen und zu erinnern. Immerhin war es ein Sprung, den wir als Vierzehnjährige ins Rentenalter verkraften mussten. Dazwischen lagen weitere Schul- und die Studienjahre, wir hatten interessante Berufsjahre hinter uns, hatten geheiratet und Kinder bekommen, waren mittlerweile Großmütter und mit Ehrenämtern beschäftigt. Seltsam, dass wir denselben Beruf gewählt, ähnliche Interessen entwickelt hatten und dass auch unsere familiären Situationen sich sehr ähnelten. Aber meine Frage, die ich unbedingt beantwortet haben wollte, schobst du energisch von dir: „Nein, nicht am Telefon. Aber ich werde es dir erzählen. Später. In Rostock.“
Ich lud sie zur nächsten Hanse-Sail Anfang August ein, buchte einen Segeltörn auf Warnow und Ostsee und freute mich auf ein paar schöne Tage mit ihr. Und wieder hielt Rosi Wort. „Lange konnte ich nicht nach Rostock kommen“, begann sie, „denn diese Stadt erinnert mich an meine schlimmsten Lebenserfahrungen. Nur eine Therapie und die Erinnerungen an dich und deine Familie halfen mir letztlich, mein Trauma zu überwinden.“ Und dann erfuhr ich von ihrer Tragödie, die mich fassungslos machte.
Mit vier Jahren waren Rosi und ihr jüngerer Bruder von ihrer Mutter verlassen worden. Einen Vater hatte sie nie gekannt. Als sie eines Morgens wach wurde, war die Mutter nicht mehr da. „Bis heute weiß ich nichts über sie und die Gründe für ihr Verschwinden. Wir Kinder waren schuld, wir hatte sie dazu gebracht, dass sie ein Leben ohne uns wollte. Das jedenfalls redete ich mir damals ein.“ Viele Jahre später hat ihr Bruder Nachforschungen angestellt und erfahren, dass sie in Dänemark lebt.
Die Geschwister kamen ins Kinderheim, an das sie sich nicht ungern erinnerte. Nur, wenn potenzielle Pflege- oder Adoptiveltern ins Heim kamen, dann habe sie vor Angst gezittert. Oder war es Hoffnung? Dann mussten sie sich in einer Reihe aufstellen und wurden begutachtet. Eins Tages kamen ihre späteren Pflegeeltern. SIE sagte – als sie das Interesse ihres Mannes spürte: „Die nicht, die sieht ja wie eine Zigeunerin aus.“ Aber ER setzte sich durch und Rosi durfte als Pflegetochter eines angesehenen Architekten das Heim verlassen. Ihren Bruder wollte niemand, er blieb ein Heimkind und wurde als erwachsener Mann ‚Kapitän auf großer Fahrt‘ und Familienvater.
Das Verhältnis zu ihrem Pflegevater war von großer Zuneigung geprägt. Die beiden mochten sich, ihm hat Rosi ihr großes Kunstverständnis und ihr Wissen über Kultur und Architektur zu verdanken. Nur, er war sehr selten zu Hause, sein Arbeitsort wurde Berlin. Hier lehrte er an einer Hochschule und fungierte als Berater beim Wiederaufbau der DDR-Hauptstadt. So ahnte er nichts von den Torturen und Schikanen, denen Rosi durch ihre Pflegemutter ausgesetzt war. Sie wurde wie eine Haussklavin gehalten, beschimpft, geschlagen, mit allen möglichen Strafen gequält, wenn sie die Haus- und Gartenarbeit nicht korrekt genug erledigte.
Als ich auf Rosis Schilderungen etwas ungläubig reagierte, streckte sie mir ihre Arme entgegen. „Sieh mal hier, meine Handgelenke.“ Ja, sie sahen seltsam aus, vernarbt, leicht verkrüppelt. Ihr war beim Staubwischen ein Milchkännchen aus Bürgeler Keramik aus den Händen gerutscht und der Henkel war abgebrochen. „SIE hat meine meine Arme gepackt und mich so geschüttelt, dass meine Handgelenke gebrochen wurden. Ich musste dem Arzt und allen, die mich fragten erzählen, ich sei aus dem Birnbaum im Garten gefallen. Auch meinen Pflegevater musste ich anlügen.“
„Und du hast das alles so hingenommen? Hast niemandem von deinem Leben dort erzählt? Auch mir nicht!“
„Einmal hab ich mich unserem Klassenlehrer anvertraut. Du erinnerst dich doch an Herrn H.?“ Ja natürlich erinnerte ich mich. Aber er hatte Rosi nicht geglaubt, hatte es nicht für möglich gehalten, dass im Haushalt der so geachteten Familie dergleichen passiert sei. „Und dann bin ich weggelaufen. Aber die Polizei hat mich gefunden und zurückgebracht. Seitdem hatte ich nur noch Hausarrest. „
„Aber warum hast du mir nichts erzählt. ich hab nicht das Geringste mitbekommen.“ Ich war fassungslos. Wie konnte das passieren. War ich damals so unsensibel und empathielos gewesen, dass ich die Nöte meiner Freundin nicht bemerkt hatte? Ich verstand mich nicht und meine Schuldgefühle stiegen ins Unermessliche.
„Wenn ich dir etwas erzählt hätte, wäre ich noch schlimmer bestraft worden und hätte auch dich verloren. Du warst doch meine einzige Freundin.“ Schließlich – wir hatten die Jahre an der Grundschule beendet – war sie mutig und erwachsen genug gewesen, um sich ans Jugendamt zu wenden und die Pflegeeltern zu verlassen. Sie bekam einen Platz an einer Oberschule mit Internat in einer anderen Stadt und nahm ihr Leben schließlich in die eigenen Hände.
(Es geht noch weiter!)